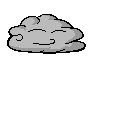Autorengeburtstage
|
|
Novembersonne In den ächzenden Gewinden Dieser Erde Werke rasten, Ehe sich das Jahr entlaubte, Erst ein Ackerknecht, ein Schnitter, Und die Schüler, zu den Bänken (von Conrad Ferdinand Meyer) |
|
Abendland Verfallene Weiler versanken Hinstirbt der Väter Geschlecht. Leise verließ am Kreuzweg (von Georg Trakl) |
|
Die Sonette auf Irene Es war November. Draußen stob der Föhn. Und unsre Wangen streifen sich und wehn. Nicht suchte Hand nach Hand. Es klang kein Wort. Wie Wellen, die ins große Meer geflossen. |
9.11.1949
Ich fing an, die zum Schreiben nötige Zeit zu vertun:
1. durch überflüssiges Herumlungern in der Stadt,
2. durch "Unlust" an der Arbeit.
Ich muss vor allem begreifen:
a) dass man sich mit Schreiben nicht befassen darf, sondern sich ihm widmen muss
(sonst bleibt man Dilettant),
b) dass man dafür nichts "opfern" muss, denn Schreiben ist das einzig
mögliche Glück.
Kurz gesagt, Disziplin ist nötig. Die vorgesehene Arbeit am selben Tag
erledigen. Jeden Tag zwei Stunden lernen, drei Stunden schreiben - unbedingt.
12.11.1949
Heute Abend das 7. Kapitel beendet. Welche Ruhe das Schaffen bereitet! Als Rajko
mich heute angriff, ich sei ein "Blatt im Wind", blieb ich völlig
ruhig. Denn ich habe etwas, was mir niemand nehmen kann - mein Werk. Es ist ständig
bei mir und schützt mich vor Unbill und Schwäche.
(Aus "Reise
in mein vergessenes Ich. Tagebuch 1942-1951"
von Aleksandar Tišma.
Aus dem
Serbischen von Barbara Antkowiak.)
Buch
bei amazon.de bestellen
(...)
War das, was ich über Uadai in Bornu erkunden konnte,
schon sehr dürftig und ungenügend, so blieben meine Bemühungen, über die
Mitte November besserte sich mein Gesundheitszustand sowie
der meiner Leute. Fieber
und Durchfälle hörten auf, wir waren über die schädlichste Jahreszeit glücklich
mit dem Leben hinweggekommen. Bei der Kostspieligkeit des Lebens in Kuka hatten
die zweihundert Taler, die ich mir geliehen, nicht lange vorgehalten, meine
baren Mittel gingen wieder zur Neige, und ich mußte allen Ernstes an die
Weiterreise denken. In Gebieten, die außerhalb des Bereichs der arabischen und
berberischen Kaufleute liegen, wo infolge dessen kein Geldumlauf stattfindet,
konnte ich hoffen, gegen meine Waren, gegen Glasperlen und dergleichen alles zum
Unterhalt Nötige einzutauschen; für die Ausrüstung an Lasttieren und
sonstigen Reisebedarf aber rechnete ich auf die Freigebigkeit des Sultans. (...)
(Aus
"Quer durch Afrika. Die Erstdurchquerung der
Sahara
vom Mittelmeer zum Golf von Guinea 1865 - 1867" von Gerhard Rohlfs)
Den
Himmel über Meran kenne ich nicht. Obwohl ich unter ihm geboren bin an einem Novembermorgen.
Obwohl dort meine Eltern begraben sind (unter einem stetig sich verändernden
Himmel).
Ich bin von dort weggeführt worden an der Hand meines Vaters oder meiner Mutter
oder eines Geschwisters, war also nicht alleine am Abschiebebahnhof Meran-Untermais,
vierjährig, ohne genug Zeit gehabt zu haben, den Typus Wind unserer Gegend -
Westwind oder Südwind - kennenzulernen. Es war für mich zu früh, die
Palmwedel auf der Kurpromenade zu bemerken, vielleicht aber waren sie mir so
selbstverständlich gegenwärtig wie der Schnee auf den Bergen ringsum oder im
Sommer die Weinpergeln auf den Hügeln. Für mich war der Meraner Himmel das
Gesicht meiner Mutter, das sich über mich gebeugt hat, und dieser Himmel hat
sich fünfmal teilen müssen, wir waren eine kinderreiche Familie.
Und auch dieses verdanke ich Meran (wenn nicht noch anderes mehr): die
Dufterinnerung, ja ich erinnere mich an den Bodengeruch unserer Parterrewohnung,
an die Nähe, die sich ergab von der Matratze aus, die platt auf dem Erdboden
gebreitet lag, und der Übersicht, die unsere Katze wohl noch besser hatte als
ich - die Muina schlief bei mir und ich roch nicht nur ihr warmes Fell, ich roch
die Küche, auch die Angst im Haus vor dem Auswandern, gewiß roch ich nicht den
Himmel über Meran. Eher schon die Schuhcreme auf meines älteren Bruders
Lackschuhen, auf die er so stolz war, die er immer bewundert hatte an den
Füßen der noblen Kurgäste, und in denen er nun, d.h. damals im Jänner
neunzehnvierzig, jämmerlich fror, während wir auf dem Bahnhof Meran-Untermais
auf den Zug "Heim ins Reich" warteten. Wir waren die Kinder eines
ehemaligen Hotelhausmeisters, also auch Hotelschuhputzers, und zuletzt (unter
Mussolinis Regime) eines Langzeitarbeitslosen.
(Aus dem Erzählband "Der Himmel über Meran" von Joseph Zoderer)
|
Ein Sohn
verbringt die Nächte am Kopfende des Bettes seines sterbenden Vaters, und
er folgt mit Blicken immer mehr der Pflegerin Laura. Eine Mutter schleicht
nachts mit der Taschenlampe durchs Haus und weckt ihre Familienmitglieder
mit einem Lichtstrahl ins Gesicht. Ein Liebespaar verlebt das Ende seiner
Liebe am Meer, und als einzige Gemeinsamkeit ist Ihnen die Nähe ihrer Füße
geblieben. Joseph Zoderer erzählt von Menschen, die mit dem Leben nicht
zurechtkommen - in einer klaren, nüchternen und zugleich ungemein starken
Sprache. (Hanser) |
wer sich der Revolution verschreibt, pflügt
das Meer
Dieser desillusionierte Satz steht in
einem Brief vom 9. November 1830. Simón Bolívar richtete ihn an
General Juan José Florés, den er zum Staatschef von Ecuador gemacht hatte.
Die Reiterstatuen Bolívars überall auf den Plätzen Lateinamerikas waren
noch nicht aufgestellt, als dieser bei Santa Marta an der Karibikküste des
heutigen Kolumbien ein letztes Mal vom Pferd stieg. Der Libertador ist ein
alter Mann von siebenundvierzig Jahren mit schwindsüchtiger Lunge, der in
einem Korbsessel, den ein aufmerksamer Sekretär in den Sand gestellt hat,
allein am Meer sitzt. Mit Schreibzeug in der Hand beobachtet er den endlosen
Wellengang und seine eigene, stürmische Vergangenheit.
Ein Monat bleibt ihm noch zu leben.
Woran mag der aufgezehrte General mit der fiebernassen Stirn jetzt denken,
wenn er auf sein auseinanderfallendes Lebenswerk blickt, jener General mit
den langen Koteletten und dem messerscharfen Gesicht namens Simón Bolívar,
den ich in dem Augenblick, da sich die Fäden seines bewegten Lebens lösen,
gerne heiter und zur Ruhe gekommen wüsste? Sieht er noch einmal mit einem Lächeln
seine Kindheit in Caracas vor sich, den kleinen, blassen jungen Mann von
damals, der mit sechzehn Jahren den Mut oder die wahnwitzige Dreistigkeit
besaß, dem spanischen Vizekönig bei einem Empfang 1799 in Mexiko seine
Bewunderung für die Französische Revolution zu verkünden?
Wieder einmal hat er, der dem spanischen Joch in endlosen, siegreichen Kämpfen
die Hälfte Lateinamerikas entrissen hatte, der Staatschef der damaligen
bolivarischen Republik von Venezuela, des damaligen Großkolumbien, sowie
Perus und Boliviens geworden war, der immer wieder aus Verdrossenheit zurücktrat
und seine Ämter dann von Neuem wieder einnahm, das Präsidentenamt der
Republik in einer Kurzschlusshandlung aufgegeben.
Der General, den wir uns heute nicht mehr vorstellen können, ohne an die
Romanfigur zu denken, die der kolumbianische Schriftsteller Gabriel García
Márquez aus ihm gemacht hat, wie wir uns auch die letzten Tage des
Alkibiades oder Alexanders des Großen nicht vorstellen können, ohne uns an
die Sätze Plutarchs zu erinnern, fährt von Bogotá kommend mit seiner
Leibwache den Río Magdalena bis zur Küste hinunter. Es ist ein langsame
Prozession von Schiffen, die still unter dem smaragdfarbenen Tunnel des
Dschungels entlanggleiten und dabei den Teppich der Wasserpflanzen
auseinanderreißen. Simón Bolívar liegt in einer Hängematte und wird von
seinen Männern mit Segeln aus getrockneten Palmblättern vor der Sonne
geschützt. Während er sich in seinem Fieberdelirium verliert, hört er dem
Geschrei der unsichtbaren Affen im Urwald zu, beobachtet die großen
Goldaugen der Krokodile dicht über den Wasserlinsen und atmet die klebrigen
Ausdünstungen des Flusses ein. Was wäre wohl gewesen, wenn die junge Frau
mit dem langen schwarzen Haar, die er 1802 in Madrid geheiratet hatte, wenn
die schöne María Teresa Rodríguez del Toro überlebt hätte? Wenn sie
nicht ein Jahr später, kurz nach ihrer Ankunft in Amerika, in Caracas
gestorben wäre? Wo wären sie beide heute?
Und wäre er auch gleich wieder nach Europa aufgebrochen, um 1804 an der Krönung
Napoleon Bonapartes teilzunehmen, wenn ihr Tod dem einundzwanzigjährigen
Witwer nicht das Herz gebrochen hätte? Hätte er auch dann, geblendet von
der Prachtentfaltung der Timokratie, gleich nach seiner Rückkehr nach
Amerika zu den Waffen gegriffen? Hätte er sich in das Schlachtengetümmel
geworfen, wenn ihn jede Nacht das duftende, lange schwarze Haar der schönen
María Teresa überflutet hätte?
Seit dem Tod seiner Frau ist Simón Bolívar auf der Flucht, er hat keine
Heimat mehr auf Erden. Seit zwanzig Jahren vertröstet der ruhmreiche
Libertador mit dem gezückten Säbel unaufhörlich eine Geliebte nach der
anderen mit dem scheinheiligen Versprechen auf eine baldige Rückkehr. Und
die vielen Bibliotheken, die er in jeder Stadt gegründet hat, in der er
lebte, in Madrid und Caracas, Paris, Bogotá und Lima, hat er immer wieder
seinen Freunden anvertraut.
Er weiß, dass irgendwo in dem einen oder anderen der zahlreichen Koffer und
Metallkisten, die ihn bei seiner letzten Reise auf dem Magdalenenstrom
begleiten, zwischen seltenen Stoffen und Silberbesteck, das sein Monogramm
trägt, die beiden einzigen Bücher liegen, die er überallhin mitgenommen
hat, in seine Paläste ebenso wie in die gefährlichen Feldlager in der
Wildnis: Vom Gesellschaftsvertrag von Jean-Jacques Rousseau und Die
Kriegskunst von Raimund Montecuccoli. Beide Bücher in französischer
Sprache hatten vor ihm Napoleon Bonaparte gehört und waren ihm nach dem Tod
des Kaisers auf Sankt Helena von seinem englischen Freund, General Wilson,
geschenkt worden.
Westlich der Mündung des Magdalenenstroms, in Santa Marta, wartet Simón
Bolívar auf ein Schiff, das ihn, sollte es eintreffen, ein letztes Mal nach
Europa bringen könnte. Oder wartet er darauf, dass man noch einmal den
Kotau vor ihm macht, dass man ihn bittet, noch einmal die Macht zu übernehmen?
Er schreibt viel, schlägt seine letzte briefliche Schlacht gegen das
Auseinanderfallen seiner großen Republik, aber er weiß, dass er im Sterben
liegt, dass das schöne Gebäude, das schon jetzt erste Risse zeigt, nach
seinem Tod in Stücke fliegen wird, und dass die Diadochenkämpfe unter
seinen Männern in Venezuela bereits ausgebrochen sind.
Nach vierzehn Jahren ununterbrochener Kriegführung müsste er eigentlich
wieder in den Sattel steigen, doch sein bestes Pferd, den legendären Palomo
Blanco, hat er in Bolivien zurückgelassen. Er müsste noch einmal von der
Karibikküste bis zur chilenischen Wüste durch das Reich ziehen, die Unbotmäßigen
und Sezessionisten niederwerfen, die Umstürzler erschießen lassen, alles
noch einmal von vorne beginnen, aber er hat nicht mehr die Kraft dazu, er
spuckt Blut auf seine schöne himmelblaue Uniform mit Knöpfen aus reinem
Gold.
Sterbend sitzt der Schwindsüchtige, der agnostizistische Libertador, der
nicht einmal auf den Beistand der Götter hoffen kann, in seinem Korbsessel
am Strand. Jetzt ist die Zeit, Bilanz zu ziehen und zu bereuen. Ob er an die
Auseinandersetzungen um die Regentschaft von Santa Marta denkt, um die im
16. Jahrhundert an dieser Stelle Bartolomé de Las Casas und Gonzalo Fernández
de Oviedo gegeneinander kämpften? Kämpfe, die wie viele andere in
Vergessenheit geraten, von den Meeresfluten geschluckt worden sind. Er
betrachtet die weißen Muscheln im Sand, das türkisfarbene Wasser der
Karibik und die Wellen, die sich am Korallenriff brechen. Wer sich der
Revolution verschreibt, pflügt das Meer. Er denkt an die große Insel
Kuba hinter dem Horizont, die er Spanien entreißen wollte. Es unterlassen
zu haben, bedauert er auf militärischem Gebiet am meisten.
Aber er vermisst auch die vielen blühenden Frauen mit der Süßholzhaut,
die in den leuchtenden Farben der kreolischen Mode gekleidet sind und die
ihm als jungem Revolutionär seine Witwenschaft im Exil auf Curaçao versüßt
haben. Und außerdem trauert er seinem Freund Manuel Piar nach, dem jungen
Mulatten aus Curaçao, der die Insel mit ihm verlassen hatte und an seiner
Seite im Laufe der Revolutionskriege zu großem Ruhm gekommen war, bis der
zum General aufgestiegene Piar zu ehrgeizig wurde, und Simón Bolívar ihn
vor dreizehn Jahren in Angostura tief betrübt erschießen ließ. Er
erinnert sich, dass er es abgelehnt hatte, an der Exekution teilzunehmen,
und der Truppe am nächsten Tag erklärte: Gestern war ein schmerzlicher
Tag für mich.
Vielleicht aus Koketterie malt sich Simón Bolívar in seinen letzten
Briefen aus, sein Name würde nirgendwo in die Geschichte eingehen. Und doch
stehen auf jeder Plaza Mayor Reiterstatuen von ihm, hat man
Prachtstraßen, einen Flughafen in Caracas, einen in Santa Marta, eine
Metrostation in Paris, eine kubanische Zigarre, eine Währung und ein Land,
in dem Che Guevara sterben sollte, nach ihm benannt.
Und für alle, deren Lebensstationen ich in meinen Notizbüchern festhalte,
von Francisco Morazán bis William Walker, war Simón Bolívar ein unübertreffliches
Vorbild, ob sie es zugaben oder bestritten. El Libertador stirbt am 17.
Dezember in San Pedro Alejandrino.
Wir schreiben das Jahr 1830.
In Mittelamerika steht zu dieser Zeit General Morazán an der Spitze der
zentralamerikanischen Föderation, die Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua und Costa Rica in einem Staat vereinigt. Wie Simón Bolívar
verausgabt er sich unablässig in siegreichen Schlachten, bevor er das prächtige
Staatengebilde einstürzen sieht und eines Morgens nach Lima fliehen muss.
Sechs Jahr zuvor war Lord Byron im Kreise griechischer Aufständischer in
Messolongi gestorben.
William Walker ist zu diesem Zeitpunkt ein schwächlicher Knabe von sechs
Jahren in Nashville, Tennessee. Er hat noch nichts von Lord Byron gelesen.
Der Name Simón Bolívar ist ihm noch unbekannt.
(Aus dem Roman
"Pura Vida.
Leben und Sterben des William Walker" von Patrick
Deville.
Aus dem Französischen von Holger Fock.)
Die
Romanbiografie des Abenteurers William Walker, des "Don Quichotte
Mittelamerikas", und zugleich ein vielschichtiges Panorama revolutionärer
Mythologien und Utopien.
Sensationsbericht, Reisetagebuch, Abenteurerbiografie und wissenschaftliches
Dokument - all das vereint Patrick Deville in seinem von der französischen
Kritik bejubelten Roman "Pura Vida": Im Zentrum steht das außergewöhnliche
und faszinierende Leben des Abenteurers und barbarischen "Don Quichotte
Mittelamerikas" William Walker, der in den 1850er Jahren im Dschungel
Mittelamerikas die Republik Sonora ausruft, sich später zum Präsidenten
von Nicaragua ernennt und schließlich von der honduranischen Regierung
exekutiert wird. Mythenumwoben diente Walker als Vorlage zahlreicher
Interpretationen, u.a. für Gillo Pontecorvos preisgekrönten Film "Queimada"
(1969, mit Marlon Brando als William Walker und Filmmusik von Ennio
Morricone).
"Pura Vida" aber ist mehr als bloß eine Romanbiografie William
Walkers, denn Patrick Deville verwebt dessen Geschichte mit jener der
sandinistischen Revolutionäre: Vergangenheit und Gegenwart überlagern sich
zu einem vielschichtigen Panorama revolutionärer Mythologien und Utopien. (btb)
"Pura
Vida. Leben und Sterben des William Walker" bei amazon.de bestellen
14.
November 1917
Also, nach meiner Flucht aus der Moskauer Heilanstalt des Doktors ... (Name
sorgfältig gestrichen) bin ich wieder zu Hause. Wie ein Schleier verhüllt der
strömende Regen die Welt. Mag er. Ich brauche sie nicht, ebensowenig wie mich
jemand auf der Welt braucht. Die Schießerei und den Umsturz habe ich in der
Heilanstalt miterlebt. Aber der Gedanke, die Kur hinzuschmeißen, war schon vor
den Moskauer Straßenkämpfen heimlich in mir gereift. Ich bin dem Morphium
dankbar, dass es mich mutig gemacht hat. Keine Schießerei jagt mir Angst ein.
Was kann überhaupt einen Menschen ängstigen, der nur an eines denkt - an die
wundersamen göttlichen Kristalle? Als die Pflegerin, ganz kopfscheu von dem
Kanonendonner ... (Hier fehlt eine Seite) ... diese Seite herausgerissen, damit
niemand je die schmachvolle Schilderung liest, wie ein Mensch mit Diplom
diebisch und feige flieht und seinen eigenen Anzug stiehlt.
Aber was ist schon der Anzug! Ich habe ein Krankenhaushemd mitgenommen. Es war
mir egal. Am nächsten Tag, nachdem ich mir eine Injektion gemacht hatte, wurde
ich wieder rege und kehrte zu Doktor N. zurück.
Er empfing mich mitleidig, aber durch das Mitleid schimmerte Verachtung. Das
hätte er sich sparen können. Schließlich ist er Psychiater und sollte wissen,
dass ich nicht immer Herr meiner selbst bin. Ich bin krank. Wozu mich verachten?
Ich gab das Krankenhaushemd zurück.
"Danke", sagte er und fügte hinzu: "Was gedenken Sie jetzt zu
tun?"
Ich sagte forsch, denn ich war im Zustand der Euphorie: "Ich habe
beschlossen, in meine Einöde zurück zu kehren, zumal mein Urlaub zu Ende ist.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe, ich fühle mich bedeutend besser. Ich
werde die Kur zu Hause fortsetzen."
Er antwortete: "Sie fühlen sich nicht im Geringsten besser. Lächerlich,
dass Sie mir so etwas sagen. Dabei genügt ein Blick auf Ihre Pupillen. Wem
erzählen Sie so etwas?" (...)
(Aus der
Erzählung "Morphium" - enthalten in "Die
rote Krone. Autobiografische Erzählungen und Tagebücher"
von Michail Bulgakow. Aus dem Russischen von Thomas Reschke)
|
In der
autobiografischen Prosa beschreibt Michail Bulgakow seine Erfahrungen,
Hoffnungen, Illusionen und Enttäuschungen zwischen 1916 und 1934. (Volk
& Welt) |
[Hamburg,]
29. XI. 1895
Meine liebste Anna!
Sei mir gegrüßt am heutigen Morgen! Wie fühle ich mich beglückt, daß ich
Dir es sagen darf, was dieser Tag für mich bedeutet.
Er ist in ureigenstem Sinne zu meinem Geburtstag geworden! - So, siehst Du mein
Lieb?, jetzt habe ich Dir doch meinen Geburtstag verrathen.
Vor einigen Tagen hast Du mir angedeutet, daß die Zahl 23 in Deinem Leben
bedeutungsvoll ist. - Hast Du es geahnt, was dieser 23. Geburtstag für Dich
bedeuten wird?
In wenigen Stunden werde ich Dir in die lieben Augen blicken. Ich kann es kaum
erwarten. Wird einmal der Tag kommen, wo ich es immer thun darf?
Komm nur recht bald! - Ich werde in der heutigen Probe gar nicht abklopfen. Ich
fürchte überhaupt, daß ich jetzt ein sehr "ungewissenhafter"
Kapellmeister sein werde. - Seit ich ein so seliges Wissen habe, habe ich mein
Gewissen verloren.
Sag mir heute schnell in einem unbewachten Augenblick, ob Du mich lieb hast.
Meine Geliebte, Du mußt es mir noch oft sagen, bevor ich es zu voller
Sicherheit weiß, Du "Feind", vor dem ich so schnell capitulirt habe -
und mich auf Gnade und Ungnade ergeben! Welches Glück für mich, daß es auf
Gnade war! Ja? Ja? Sag mir’s! Meine Liebe! Auf Wiedersehen!
Dein
Gustav
29. Nov[ember] 1895
Quelle: Autograph, ÖTM, AM 29086 BaM. - Datierung: von fremder Hand am Anfang
des Briefes: 29. XI. 1895; von Mahlers eigener Hand nur die Datierung am Ende
des Briefes.
(Aus "Gustav
Mahler. 'Mein lieber Trotzkopf, meine süße Mohnblume'"
Briefe an Anna von Mildenburg.
Herausgegeben und kommentiert von Franz Willnauer)
|
Hamburg im
Frühherbst 1895: Die 23-jährige Sängerin Anna von Mildenburg debütiert
am Stadttheater und wird über Nacht zum Star. Am Pult: ihr Mentor, der
damals 35-jährige Gustav Mahler. Bisweilen mehrmals täglich lässt er
ihr Botschaften zukommen. Von Anfang an geht es dabei um mehr als nur künstlerische
Fragen. Die mehr als 200 Briefe, von denen bisher nur ein Dutzend bekannt
waren, dokumentieren eine hochemotionale Liebesgeschichte und geben einen
faszinierenden Einblick in das Musikleben des Fin de siècle. Ergänzt
wird der von Franz Willnauer edierte Band durch die Korrespondenz zwischen
Anna von Mildenburg und Alma Mahler sowie ein vollständiges
Auftrittsverzeichnis der legendären Sängerin. (Zsolnay) |
| Bauernregeln für den Monat
November: |
|
| Schnee am Allerheiligentag (1. November) selten lange liegen mag. |
|
| Bringt Sankt Martin (11. November)
Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein. |
|
| Sankt Elisabeth (19. November) zeigt an, was der Winter für ein Mann. |
|
| Wie St. Kathrein (25. November) wird's auch an Neujahr sein. |
|
| Wenn es an Andreas (30. November) schneit, der Schnee hundert Tage liegen bleibt. |
|
| Wenn im November die Stern' stark leuchten, lässt dies auf bald viel Kälte deuten. |
|
| Hat der November einen weißen Bart, dann wird der Winter lang und hart. |
Im Garten kehrt Ruhe ein ... (zumindest oberflächlich betrachtet):
Im November gibt
es in unseren Breiten im Freien nichts auszusäen.
Zumindest die Broccoli-Ernte ist weiterhin möglich.
Schnittlauchballen ausgraben, einmal ordentlich vom Frost erschüttern lassen,
und dann zum Antreiben auf dem Fensterbrett eintopfen. Auf diese Weise hat man
schon sehr bald ganz frischen, würzigen Schnittlauch zur Verfügung.
Obstgehölze und Beerensträucher können noch gepflanzt werden.
Rosen anhäufeln und nötigenfalls mit Fichtenreisig bedecken. Der Rückschnitt
wird erst im Frühjahr durchgeführt.
Solange der Boden nicht gefroren ist, können Sie durchaus noch Stauden,
Blumenzwiebeln, Sträucher, Rosen und Kletterpflanzen einsetzen.
Es ist nicht notwendig, im Garten für "Sauberkeit" (nach menschlichem
Ermessen) zu sorgen. Samenstände sind vielen Tieren als Nahrungsquelle
willkommen, liegenbleibende Pflanzenreste dienen als Überwinterungsquartiere
für allerhand Kleingetier.